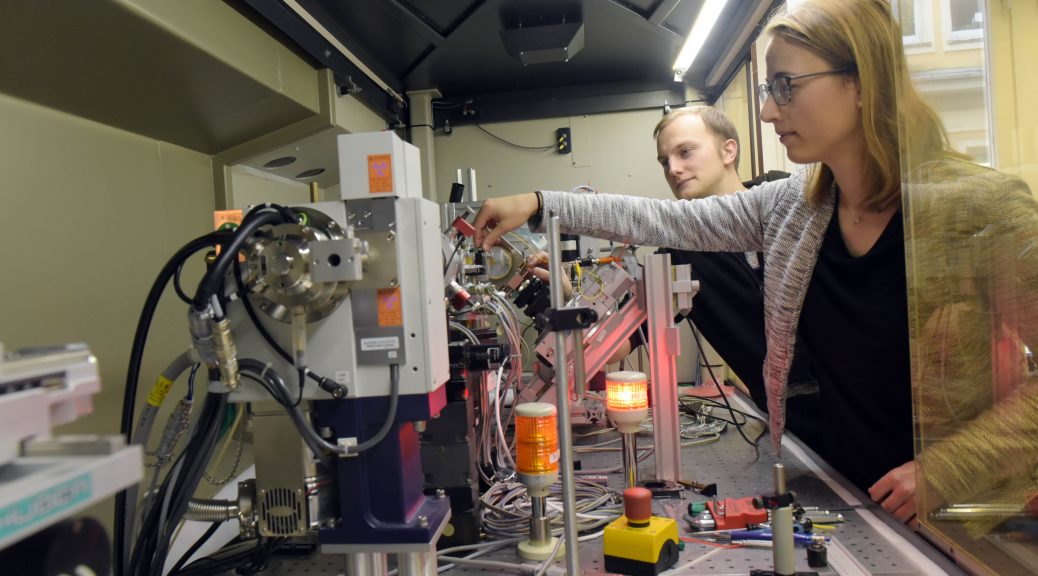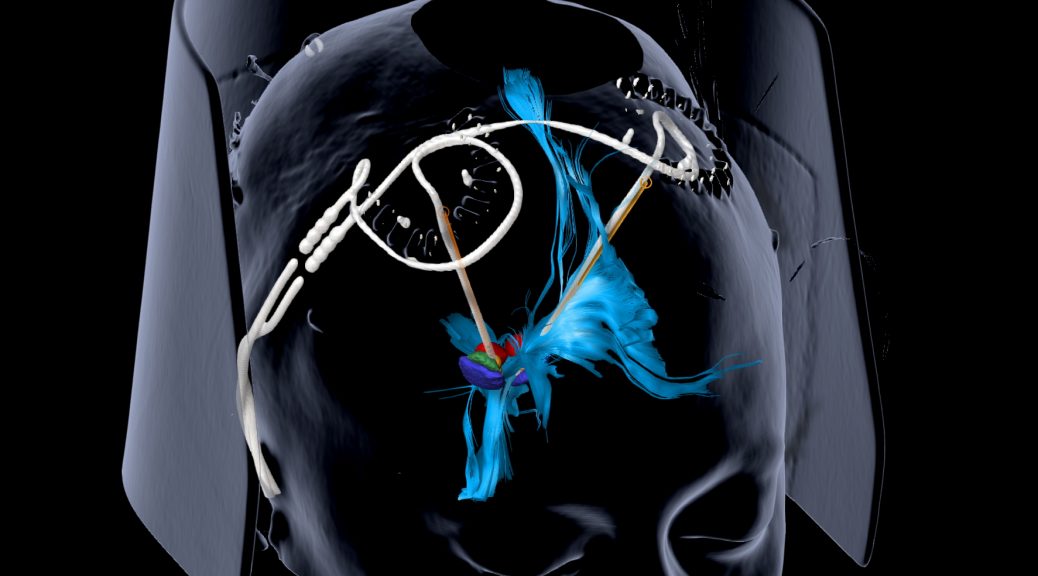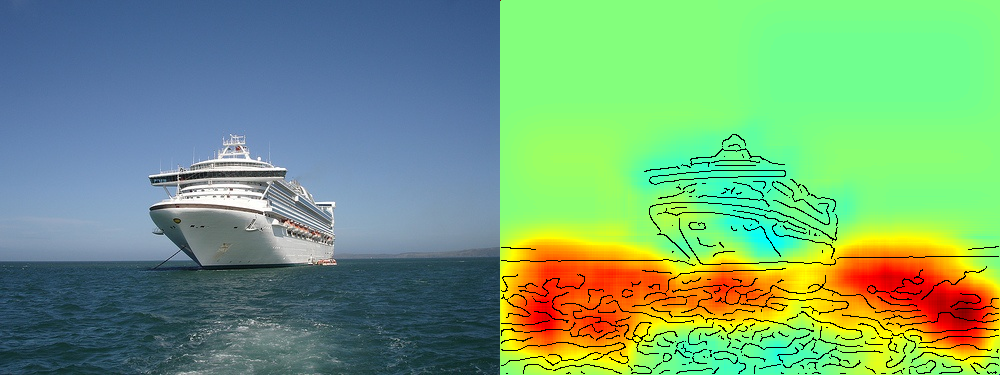Sie sind ein faszinierender Anblick: Unterwasseraufnahmen, in denen Haarsterne und Seelilien Ihre Tentakel rhythmisch mit der Bewegung des Wassers hin- und herwiegen. Aus der arktischen Tiefe stammen solche Bilder und Filme von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen, die am fast unerreichbaren Meeresgrund unterwegs sind.
Die oben genannten, zu den Schwammarten gehörenden Meerestiere, sind wortwörtlich mit ihrem Lebensraum verwachsen. Sie leben auf sogenannten Dropstones. Das sind Steine oder auch ganze Felsblöcke, die an Land in einen Gletscher einfrieren und von Eisbergen ins Meer hinaus transportiert werden. Sobald das Eis schmilzt, sinken diese Steine auf den Meeresgrund. Dort bieten sie genau das harte Substrat, auf das viele der sesshaften Arten angewiesen sind. Ihre Nahrung fischen diese sich dann mit Filterapparaten oder Fangarmen aus dem Wasser.
TIEFSEEOBSERVATORIUM HAUSGARTEN
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) erforschten nun, wie lange es dauert, bis sich die ersten Siedler in der Tiefsee der Arktis niederlassen. Auch wollten sie wissen, wie sich die Lebensgemeinschaft danach weiterentwickelt. „Darüber wusste man bisher so gut wie gar nichts“, erklärt Michael Klages vom AWI. Zwar gibt es einige Studien, die solche Fragen in der Antarktis untersuchten. Doch hatten sich diese auf flache Meeresbereiche konzentriert. Hier herrschen andere Lebensbedingungen.
Aber nun gibt es neue Erkenntnisse aus dem Tiefsee-Observatorium namens Hausgarten. Es liegt in der Framstraße zwischen Spitzbergen und Grönland. Das AWI führt hier verschiedene ökologische Langzeituntersuchungen durch.
So stellten Michael Klages und seine Kolleginnen und Kollegen aus der Tiefseeforschungsgruppe des AWI im Juli 1999 einen schweren Metallrahmen mit sogenannten Besiedlungsplatten aus Klinkersteinen, Plexiglas und Holz auf den Meeresboden. In einer Wassertiefe von 2500 Metern sollte dieser den sesshaften Tiefseebewohnern Halt bieten. Und dann hieß es für die Forschenden abwarten, was passiert.
Zunächst statteten sie dem Dropstone-Imitat in den Jahren 2003 und 2011 per ferngesteuerter Unterwasserfahrzeuge einige Besuche ab. Ende August 2017 holten sie das Gestell schließlich wieder an die Oberfläche. Die Erstautorin der aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichung, Kirstin Meyer-Kaiser, die mittlerweile im Meeresforschungsinstitut Woods Hole Oceanographic Institution im US-Bundesstaat Massachusetts arbeitet, nahm die geborgenen Besiedlungsplatten anschließend „unter die Lupe“. Sie zählte die einzelnen Organismen, sammelte sie ab und ordnete sie taxonomisch ein, klassifizierte sie also.

BESIEDLUNG VOM EINZELLER ZUM MEHRZELLER IN ZEITLUPE
„In diesem Experiment haben wir gesehen, dass die Besiedlung solcher Habitate in der arktischen Tiefsee extrem langsam vor sich geht“, resümiert Michael Klages. Nach vier Jahren hatten sich auf den Platten nur Einzeller aus der Gruppe der Foraminiferen eingefunden. Nach zwölf Jahren war mit dem Polypen Halisiphonia arctica nur ein einziges mehrzelliges Tier dazugekommen. Und selbst nach 18 Jahren beschränkte sich die Zahl der wirbellosen Mehrzeller auf gerade einmal 13 Arten.
Aus dieser bescheidenen Ausbeute schließen die Forscher allerdings nicht, dass die natürlichen Hartsubstrate keine wichtigen Habitate wären – ganz im Gegenteil: „Ohne sie würde es etliche sesshafte Tiere in der arktischen Tiefsee gar nicht geben“, betont Michael Klages. Der in den Meeren inzwischen allgegenwärtige Zivilisationsmüll scheint dabei kein guter Ersatz zu sein. Zwar hat das AWI-Team auf den von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen aufgenommenen Bildern durchaus schon eine Plastikflasche gesehen, auf der eine Seelilie wuchs. „So sind wir darauf gekommen, bei unserem Experiment auch Plexiglasplatten zu verwenden“, erklärt der Forscher. „Wir wollten sehen, ob diese genauso gut besiedelt werden können wie ein naturnaher Untergrund.“ Das ist offenbar nicht der Fall. Jedenfalls hatten sich nach 18 Jahren auf dem Kunststoff deutlich weniger Tiere eingefunden als auf den Klinkersteinen.
EMPFINDLICHE ÖKOSYSTEME
Auch letztere konnten allerdings bei weitem nicht mit einem benachbarten Felsenriff mithalten, wo sich immerhin 65 verschiedene Wirbellose nachweisen ließen. Möglicherweise haben also selbst fast zwei Jahrzehnte nicht genügt, um auf den Platten die theoretisch mögliche Artenvielfalt zu erreichen. Das erwähnte Riff ist dagegen deutlich älter und hatte entsprechend mehr Zeit, um eine größere Palette von Bewohnern anzulocken.
Die Ergebnisse liefern damit auch wichtige Erkenntnisse über die Empfindlichkeit von Tiefsee-Ökosystemen.
Wenn dort Störungen die sesshaften Bewohner am Meeresgrund beseitigen, dürfte es Jahrzehnte dauern, bis sich die Lebensgemeinschaft davon wieder erholt hat…“
…, warnt Michael Klages. In der Arktis können solche Störungen etwa durch Fischerei, Bohrungen nach Öl und Gas auftreten. Deutlich weitreichendere Folgen aber sind zum Beispiel in der Tiefe des Pazifiks zu erwarten, wo künftig großflächig Manganknollen abgebaut werden sollen.
Die Arbeit der Wissenschaftler wurde kürzlich in Limnology and Oceanography 2019veröffentlicht.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren:
Neumayer-Station III: 10 Jahre deutsche Antarktisforschung
Bild oben: „Dropstone“ ©ROV Kiel 6000 GEOMAR